
Stories_Ketzerbriefe: Rezension "Vermeers Hut"
Globalisierung: Wie alles begann
Ein neuer Beitrag aus den Schreibstuben der "Ketzerbriefe": Autor Peter Priskil setzt sich darin kritisch mit Timothy Brooks Buch "Vermeers Hut" auseinander, das den "Beginn der globalen Welt" im 17. Jahrhundert aufzuarbeiten versucht - mit Hilfe von Bildern des niederländischen Malers Jan Vermeer.
04.12.2009
Ein spannendes und reizvolles Unterfangen: Anhand von fünf Bildern des niederländischen Malers Jan Vermeer (1632-1675) und zweier Gemälde seiner Zeitgenossen Hendrik van der Burch und Leonaert Bramer führt der Autor den Leser in die Welt des 17. Jahrhunderts. Es sind die kleinen, auf den ersten Blick nebensächlich erscheinenden Accessoires in den stimmungsvoll wiedergegebenen Innenräumen des wohlhabenden holländischen Bürgertums - etwa ein Filzhut, eine Silbermünze, ein türkischer Teppich oder eine chinesische Porzellanvase -, die der Verfasser als "Tür" benutzt, durch die er den Leser in die Vergangenheit eintreten läßt. Und es ist eine kurzweilige, anekdotenreiche, oftmals überraschende Zeitreise, die man bei der Lektüre dieses Buches unternimmt.
Wer hätte beispielsweise gedacht, daß Vermeers berühmte "Ansicht von Delft" - auch Marcel Proust hat diesem Bild ein unvergängliches literarisches Denkmal gesetzt (petit pan de mur jaune) - eine Anspielung auf die "kleine Eiszeit" während des 17. Jahrhunderts enthält? Tatsächlich ist im Delfter Hafen, im Bildmittelgrund auf der rechten Seite, ein seinerzeit neuer Schiffstypus erkennbar, sogenannte "Heringsbüsen". Der Hintergrund: Im Zuge der globalen Abkühlung zu Beginn des 17. Jahrhunderts - so kamen u. a. die Winterbilder von Jan Brueghel dem Älteren zustande - drangen die Heringsschwärme aus der Arktis nach Süden vor und eröffneten so der niederländischen Fischerei eine Quelle neuen Reichtums. Man nimmt diese Information, die mehr als ein bloßes Detail ist, dankbar zur Kenntnis, denn sie fügt sich als Baustein in das Gebäude der Übersicht ein. Nicht minder nimmt es für das Buch ein, wenn der prächtige Hut eines holländischen Offiziers (aus Vermeers Bild "Der Soldat und das lachende Mädchen") unvermittelt zu den Indianerstämmen in der nordamerikanischen und kanadischen Wildnis führt. Die Pelze des in Europa überjagten und so gut wie ausgerotteten Bibers (Castor fiber) dienten nämlich als Basisstoff für die Herstellung von qualitätsvollem Filz. Der Handel mit dieser begehrten Ware ließ nicht nur die Profitraten der Kaufleute in ungeahnte Höhen schnellen, befriedigte nicht nur das Luxusbedürfnis des europäischen Stadtbürgertums, sondern führte zur nahezu vollständigen Ausrottung der Nager wie der Rothäute. Auch dies ein aufschlußreiches Stück "Kulturgeschichte"; gleiches gilt für die Exkursionen in den fernen Osten, nach China, Japan, Korea und den Philippinen, in den Kapiteln über Silber, Porzellan und Tabak.
Der Verfasser, mehrfach ausgezeichneter Inhaber eines Lehrstuhls für Sinologie, weiß schließlich damit zu punkten, daß er die einseitige und daher unangenehme "eurozentristische" Sichtweise verläßt und die Ära der weltumspannenden Handelsbeziehungen aus der Perspektive des ming-und qingzeitlichen China beschreibt. Hierin liegt als Fachmann für chinesische neuere Geschichte zweifellos seine Stärke, und dies sichert ihm die Sympathie eines aufgeschlossenen und neugierigen Lesepublikums.
Doch nun folgt ein gewichtiges Aber. Wenn der russische Revolutionsführer Lenin ein Buch besprach, dessen Vorzüge zwar überwogen, das aber doch entscheidende Mängel enthielt (meist, weil grundsätzliche Prinzipien der wissenschaftlichen Methodik ignoriert oder in einem Geschichtswerk die Klassenantagonismen geleugnet werden), dann gebrauchte er gern die Metapher: "Dieses Buch ist wie ein Faß Honig mit einem Löffel Teer." So etwas taugt nicht richtig als Brotaufstrich respektive zum uneingeschränkten Genuß, und ganz ähnlich verhält es sich mit Brooks Studie: Es ist kein Löffel, sondern es sind ganze Schöpfkellen des Straßenbelags, die sein Faß Honig mit Schlieren verunzieren. Es ist in seinen zentralen Aussagen ideologieverseucht, und dies mindert seinen Wert beträchtlich. Greifen wir einige Beispiele heraus.
Der Verfasser macht viel Gewese um das Phänomen der "Transkulturation", das er als die analytische Quintessenz seiner Untersuchungen vorführt (z. B. S. 11 und 141). Er meint damit die herzlich banale, aber übermäßig aufgeblähte Tatsache, daß geographisch getrennte Völker vom Zeitpunkt ihrer ersten Kontaktaufnahme an wechselseitig Sitten und Gebräuche übernehmen: So stellten europäische Stadtbürger chinesische Porzellanteller als Prunkstücke ihres Haushalts in ihre schönen hölzernen Schränke, und die Japaner bauten, zum Segen ihrer nationalen Eigenständigkeit bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, in Windeseile europäische Handfeuerwaffen nach. Der ursprünglich nur den Indianern bekannte Tabakgenuß trat seinen Siegeszug über Europa in alle Weltteile an und stieß im Reich der Mitte auf seine hingebungsvollsten Anhänger. Wer heutzutage China bereist, wird bestätigen können: dessen Bewohner quarzen bis zum Abwinken. Aber ist mit diesem maßlos aufgedonnerten Epiphänomen eine ganze Epoche, deren Wesen, deren innere Dynamik erklärt? Natürlich nicht. Der Verfasser ist kein Marxist, vielmehr meidet er die durch die Ökoanalyse von Marx und Engels ermöglichten Erkenntnisse geradezu ängstlich, vermeidet krampfhaft selbst deren Namensnennung und stürzt sich statt dessen auf ein - zudem peripheres - Überbauphänomen, das er stolz wie Oskar zum Stein der Weisen deklariert. Es wären ja auch andere Bereiche des Überbaus einer eingehenden Recherche wert gewesen, etwa die Jurisdiktion, die politischen Einrichtungen und die Techniken der Kriegsführung, die das Schicksal der Völker auf Jahrhunderte hin viel nachhaltiger festlegten als bestimmte, wenn auch noch so spektakuläre Konsumgewohnheiten. Aber hier hält sich Brook bemerkenswert zurück.
Ist dieses Urteil zu streng? Kann man sich als Historiker nicht auch mal mit netten Nebensächlichkeiten abgeben, Fragen der Mentalität und des Alltagslebens etwa, wobei hier allerdings Norbert Elias mit seinem "Prozeß der Zivilisation" das Maß für eine zwar nichtmarxistische, aber doch vorbildliche Geschichtsschreibung vorgibt? Sicher, das kann man schon, aber man sollte dann fairerweise davon absehen, die Erscheinung für das Wesen auszugeben und über eine angeblich bierernste "Basis" und staubtrockene "Ökonomie" pseudoaufgeklärt die Akademikernase zu rümpfen. Und das tut unser Autor, wenn er, bei ansonsten stupender Belesenheit, grundlegende Erkenntnisse einfach unterschlägt.
Im 17. Jahrhundert geriet die Welt unter den Hobel des stürmisch expandierenden Merkantil-Kapitalismus, und das bedeutete zweierlei: Massenelend in den frühkapitalistischen Ländern, Krieg, Zerstörung, Plünderung und Ausrottung in den restlichen Teilen des Globus. Insofern war diese Epoche tatsächlich der "Beginn der globalen Welt", wie der Untertitel von Brooks Buch lautet, aber dies heißt - und der Verfasser drückt es nie so aus -: Eine neue Produktionsweise, die kapitalistische nämlich, bemächtigt sich mit eiserner und blutiger Faust des Restes der Welt, so wie heute der US-amerikanische Monoimperialismus (wozu der Autor im übrigen vornehm schweigt; das Ideologem "Globalisierung" soll diesen Tatbestand lediglich verschleiern und verharmlosen). Natürlich zählt Brook zu jenen Akademikerkreisen, die "auch" - und stets mit etwas gönnerisch-herablassendem Unterton - ökonomische Gründe für diese Entwicklung konzedieren, etwa wenn er Gewinnstreben und Wissensbegier als Motive der zu Anfang abenteuerlichen Handels- und Kaperfahrten benennt. So etwas zählt mittlerweile zum "guten Ton" dieser pseudo-aufgeklärten Klientel: von Marx ein wenig, und sehr oberflächlich, zu parasitieren, ohne ihn zu nennen. Sicher: Es brauchte Magnetkompaß, taugliche Karten und hochseetüchtige Schiffe, um die Weltmeere zu durchqueren, aber vor allem durfte man die Kanonen und Arkebusen nicht vergessen. Marx, dessen Name der vielbelesene Autor undankbarerweise unterschlägt, bezeichnet diese Epoche als "sogenannte ursprüngliche Akkumulation" und faßt sie gegen Ende seines ersten "Kapital"-Bandes wie folgt zusammen: "Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingeborenen Bevölkerung in die Bergwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. Diese idyllischen Prozesse sind Hauptmomente der ursprünglichen Akkumulation" (MEW XXIII 779). Das klingt doch etwas anders als "Transkulturation"!
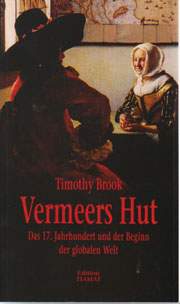 Es verhält sich nicht so, daß dem intelligenten Verfasser Marxens Analysen unbekannt geblieben wären; so prägt er beispielsweise bei der Besprechung von Vermeers Bild "Frau mit einer Waage" - es zeigt eine schwangere Frau beim Wägen von Silbermünzen - den bedenkenswerten wie bedenklichen Ausdruck von der "Ethik der Akkumulation" (S. 168). Was will er damit besagen? Wo das Wort "Ethik" fällt, ist die Theologie nicht weit. Dieser Ausdruck bezieht sich, und insoweit ist er korrekt, auf das Selbstverständnis der protestantischen Handels-und Manufakturbourgeoisie, daß das Anhäufen von Reichtum keine Todsünde - wie die kath. Kirche als Suggestionsapparat und hauptsächlicher Nutznießer der feudalen Ausbeutung wetterte -, sondern gottgewollt sei, oder in den Worten von Brook: "Gelderwerb ist eine Tugend, solange er auf ehrliche Weise geschieht." Aber was, bitteschön, soll denn hier "ehrlich" bedeuten? Man merkt dem Verfasser an, daß er, so viele "Türen" in die Vergangenheit er auch aufstößt, den eng begrenzten Horizont des behaglichen bürgerlichen Interieurs nicht zu überschreiten vermag. Marx bezeichnet als Wesensmerkmal der "ursprünglichen Akkumulation" das massenhafte Entstehen "freier" Produzenten, "frei" im Doppelsinne von persönlich-juristischer Freiheit (von den Fesseln der Leibeigenschaft nämlich) und "frei" - d. h. beraubt, enteignet - von Produktionsmitteln, und fügt die scharfsinnige Beobachtung hinzu, daß die bürgerliche Geschichtsschreibung nur den ersten, personenrechtlichen Aspekt dieser Freiheit in höchsten Tönen preist, während sie den zweiten Aspekt, die mittels brutaler Gewalt, Brandeisen und Galgen durchgeführte Enteignung der Kleinproduzenten, um sie zur Lohnarbeit erpreßbar zu machen, mit noblem Schweigen übergeht. Nichts Neues also unter der Sonne: "Ehrlicher Gelderwerb" - die Illusion der Bourgeoisie über sich selbst, die der Verfasser so gerne teilt - bedeutet während des 17. Jahrhunderts im Weltmaßstab Eroberung, Plünderung und Mord, aber in Holland selbst, als der "kapitalistischen Musternation des 17. Jahrhunderts", wie Marx sie bezeichnete? Darüber erfährt man bei Brook mit seiner heimeligen Wohnzimmerperspektive nichts, und so müssen wir uns abermals an Marx halten: "Hollands Volksmasse war schon 1648 mehr überarbeitet, verarmter und brutaler unterdrückt als die des übrigen Europas insgesamt" (ebd. 782). "Ehrlicher Gelderwerb"! "Ethik der Akkumulation"! Erst vor dem Hintergrund von Marxens Analyse wird verständlich, warum sich Zigtausende von Holländern für diese "Handelsfahrten" anheuern ließen, die einen ungeheuren Tribut an Menschenleben - zwischen einem Drittel und der Hälfte der Mannschaften - forderten: Das Elend der kapitalistischen Ausbeutung trieb die besitzlosen Holländer (später Engländer) auf die Schiffe und in die Welt. Wenn sie Glück hatten, konnten sie ihr Dasein auf Kosten der Rot-, Gelb-und Schwarzhäute fristen. Aber diese Dynamik bleibt dem Leser des Buches verborgen, vorsätzlich verborgen.
Es verhält sich nicht so, daß dem intelligenten Verfasser Marxens Analysen unbekannt geblieben wären; so prägt er beispielsweise bei der Besprechung von Vermeers Bild "Frau mit einer Waage" - es zeigt eine schwangere Frau beim Wägen von Silbermünzen - den bedenkenswerten wie bedenklichen Ausdruck von der "Ethik der Akkumulation" (S. 168). Was will er damit besagen? Wo das Wort "Ethik" fällt, ist die Theologie nicht weit. Dieser Ausdruck bezieht sich, und insoweit ist er korrekt, auf das Selbstverständnis der protestantischen Handels-und Manufakturbourgeoisie, daß das Anhäufen von Reichtum keine Todsünde - wie die kath. Kirche als Suggestionsapparat und hauptsächlicher Nutznießer der feudalen Ausbeutung wetterte -, sondern gottgewollt sei, oder in den Worten von Brook: "Gelderwerb ist eine Tugend, solange er auf ehrliche Weise geschieht." Aber was, bitteschön, soll denn hier "ehrlich" bedeuten? Man merkt dem Verfasser an, daß er, so viele "Türen" in die Vergangenheit er auch aufstößt, den eng begrenzten Horizont des behaglichen bürgerlichen Interieurs nicht zu überschreiten vermag. Marx bezeichnet als Wesensmerkmal der "ursprünglichen Akkumulation" das massenhafte Entstehen "freier" Produzenten, "frei" im Doppelsinne von persönlich-juristischer Freiheit (von den Fesseln der Leibeigenschaft nämlich) und "frei" - d. h. beraubt, enteignet - von Produktionsmitteln, und fügt die scharfsinnige Beobachtung hinzu, daß die bürgerliche Geschichtsschreibung nur den ersten, personenrechtlichen Aspekt dieser Freiheit in höchsten Tönen preist, während sie den zweiten Aspekt, die mittels brutaler Gewalt, Brandeisen und Galgen durchgeführte Enteignung der Kleinproduzenten, um sie zur Lohnarbeit erpreßbar zu machen, mit noblem Schweigen übergeht. Nichts Neues also unter der Sonne: "Ehrlicher Gelderwerb" - die Illusion der Bourgeoisie über sich selbst, die der Verfasser so gerne teilt - bedeutet während des 17. Jahrhunderts im Weltmaßstab Eroberung, Plünderung und Mord, aber in Holland selbst, als der "kapitalistischen Musternation des 17. Jahrhunderts", wie Marx sie bezeichnete? Darüber erfährt man bei Brook mit seiner heimeligen Wohnzimmerperspektive nichts, und so müssen wir uns abermals an Marx halten: "Hollands Volksmasse war schon 1648 mehr überarbeitet, verarmter und brutaler unterdrückt als die des übrigen Europas insgesamt" (ebd. 782). "Ehrlicher Gelderwerb"! "Ethik der Akkumulation"! Erst vor dem Hintergrund von Marxens Analyse wird verständlich, warum sich Zigtausende von Holländern für diese "Handelsfahrten" anheuern ließen, die einen ungeheuren Tribut an Menschenleben - zwischen einem Drittel und der Hälfte der Mannschaften - forderten: Das Elend der kapitalistischen Ausbeutung trieb die besitzlosen Holländer (später Engländer) auf die Schiffe und in die Welt. Wenn sie Glück hatten, konnten sie ihr Dasein auf Kosten der Rot-, Gelb-und Schwarzhäute fristen. Aber diese Dynamik bleibt dem Leser des Buches verborgen, vorsätzlich verborgen.
Am Anfang der kapitalistischen Ära stehen Erpressung und Raub, und dies schließt die militärischen Konflikte der europäischen Kolonialmächte untereinander mit ein. Brook illustriert dies sehr schön an der juristischen Abhandlung des Holländers Hugo Grotius, De iure praedae (Über das Beuterecht), die den »freien Welthandel« unverblümt als das Recht auf Piraterie definiert. Aber wir müssen wieder zu Marx greifen, um das ganze Ausmaß der innerkolonialistischen Konkurrenz und der Brutalität der kolonialen Ausbeutung verstehen zu lernen: "Um sich Malakkas zu bemächtigen, bestachen die Holländer den portugiesischen Gouverneur. Er ließ sie 1641 in die Stadt ein. Sie eilten sofort zu seinem Hause und meuchelmordeten ihn, um auf die Zahlung der Bestechungssumme von 21 875 Pfd. St. zu 'entsagen'. Wo sie die Füße hinsetzten, folgte Verödung und Entvölkerung. Banjuwangi, eine Provinz von Java, zählte 1750 über 80 000 Einwohner, 1811 nur noch 8000. Das ist der doux commerce [sanfte Handel]!"
Die selbstverordnete Blindheit gegenüber den Erkenntnissen von Marx und Engels zeitigt zudem zahlreiche sachliche Fehler in diesem Buch. Einleitend schildert Brook, wie ein Pionier der kolonialen Ausbeutung, der Franzose Champlain, bei den nordamerikanischen Indianern Biberpelze gegen Gerätschaften aus Metall - Waffen, Werkzeuge und Behältnisse - eintauschte. Natürlich lagen diesem Handel spezifische Bedürfnisse zugrunde, die erworbenen Güter besaßen für beide Seiten Gebrauchswert. Die Europäer benötigten die Felle, wie erwähnt, als Rohstoff für hochwertige Filzerzeugnisse, die Indianerstämme wiederum, die im Gegensatz zu den Japanern die Stufe der Metallerzeugung und -verarbeitung nicht erreicht hatten, sahen sich plötzlich im Besitz von Geräten, die ihre herkömmlichen aus Holz, Knochen und Horn an Qualität weit übertrafen. Bis dahin zählte der Biber für sie zum Inventar der Landschaft, er fällte Bäume und baute Dämme, aber nun war er zur Quelle unerwarteten Nutzens geworden. Ein Indianer äußerte begeistert gegenüber einem Missionar: "Der Biber tut viel Gutes für uns. Er macht Kessel, Beile, Schwerter, Messer, Brot, kurzum, er macht einfach alles." Und er frohlockte weiter: "Die Engländer haben keinen Verstand; sie geben uns einfach so zwanzig Messer für ein Biberfell."
Brook kommentiert diesen Tausch mit den Worten: "Beide Seiten dachten, daß die anderen zuviel bezahlten, und in gewissem Sinne hatten beide recht; nicht zuletzt deshalb erwies sich dieser Tauschhandel als ein solcher Erfolg" (S. 53). Und das stimmt nun gerade nicht - sechs, setzen. Denn der Verfasser wirft Gebrauchs- und Tauschwert durcheinander, kennt vielleicht nicht einmal diese Unterscheidung und damit das Einmaleins der (bürgerlichen!) Ökonomie. Der (Tausch)Wert der Waren bestimmt sich nicht nach der Dringlichkeit des Bedürfnisses, sondern nach der notwendigen (durchschnittlichen gesellschaftlichen) Arbeitszeit zu seiner Herstellung. Der Indianer wußte einfach nicht, daß im entwickelten Manufakturwesen die Herstellung eines Messers nur einen Bruchteil, vielleicht ein Dreißigstel, jener Zeit erforderte, die er zum Jagen, Töten und Enthäuten eines Bibers brauchte. Dieses Tauschgeschäft fand also, wie alle Transaktionen des frühen Fernhandels, unter Umgehung des Wertgesetzes (mittels Betrug) statt, da der einen Seite nicht bekannt war, wieviel durchschnittliche Arbeitszeit die Herstellung des von ihr begehrten Produkts erforderte, und dieses Unwissen von der Gegenseite ausgenutzt wurde. Nur der Indianer ist also der Geprellte, so wie der Neger, der Elfenbein gegen Glasperlen tauscht. Marx lesen macht einfach klüger ...
Ganz konfus wird es im Kapitel über den weltweiten Silberhandel, wo es u. a. heißt: "Die Macht, die Silber über die Welt ausübte, war denjenigen, die tatsächlich darüber nachdachten, eine Art Mysterium. Es konnte bisher zu dekorativen Zwecken verwendet werden, doch seine sonstige Nützlichkeit war beschränkt. Die meisten Leute wollten Silber haben, aber nur, um damit andere Dinge zu erwerben. Sein eigener Wert war rein willkürlich" (S. 170). Die hier beschriebene Entwicklung fand 2000 Jahre bevor die Niederländer in See stachen statt, im antiken Griechenland des 6. Jahrhunderts v. u. Z.: aus dem Schmuck-und Dekorationselement Silber war ein allgemeines Tauschäquivalent, vulgo Geld geworden, und in dieser Eigenschaft bestimmte sich sein Wert wie der jeder anderen Ware, seien es Biberfelle oder Metallmesser, Tabakpfeifen oder Gewürze. Mit der Erschließung der Silberminen im damals peruanischen, heute bolivianischen Potosi war der Wert des Silbers aufgrund verbesserter Abbaumethoden und Schmelzverfahren gefallen, d. h. man brauchte durchschnittlich weniger Zeit zu seiner Gewinnung. Mochten seinerzeit auch keine zutreffenden Vorstellungen über das Wertgesetz existieren - "willkürlich" war der Wert des Silbers nie, so wenig wie bei jeder anderen Ware; die Holländer, Spanier und Portugiesen wußten genau, wieviel Säcke Pfeffer sie gegen ein gewisses Quantum dieses Edelmetalls eintauschen konnten. Brook betreibt hier selbst eine Mystifizierung, indem er der kindlichen (oder wahlweise ideologischen) Vorstellung anhängt, es gebe einen "Wert an sich", der wie Materiebausteine in den Elementen stecke und besonders bei den Edelmetallen "ganz ganz groß" sei (oder auch nicht). Und so fließt ihm folgender Galimathias aus der Feder: "Eines der Rätsel dieses Handels ist, daß der Rechnungswert der Waren, die offiziell in den Frachträumen der VOC-Schiffe [VOC = Niederländische Ostindien-Kompanie] zurückkehrten (...), nur ein Viertel des Silberwerts betrug. Dieses beträchtliche Defizit beunruhigte die Kompanie nicht besonders, denn die VOC verkaufte alles, was nach Europa zurückkam, zu Preisen, die die ursprüngliche Investition um ein Vielfaches übertrafen" (S. 175). Das klingt nun wie bei der Wandlung: aus Brot mach Fleisch, aus Verlust Gewinn, und das alles mit einem Simsalabimm - o Rätsel über Rätsel! Die holländischen Kaufleute mochten vieles gewesen sein, aber eins waren sie mit Sicherheit nicht: Deppen. Und so kannten sie nicht nur genau den Wert der von ihnen beförderten Waren, sondern auch die Höhe der heimischen Zolltarife, also deklarierten sie den Wert ihrer Schiffsladungen geringer (dies der ominöse "Rechnungswert"), um sie mit desto größerem Profit losschlagen zu können. Herrn Prof. Brook hätten sie allenfalls zum Kartoffelschälen angestellt.
So legt sich ein Schleier aus Mystik und Irrationalität über diese Vorgänge, die sich im Kern durch knallharte Kalkulation und rücksichtsloses Vorgehen auszeichnen - darunter ist die Weltherrschaft nicht zu haben. Dies betrifft auch jene scheinbar nebensächliche Anekdote, die der Verfasser erzählt, daß nämlich die ausgezeichneten Weltkarten der europäischen Seefahrer selbst bei chinesischen Gebildeten kaum auf Interesse stießen. Hier prallen zwei Welten aufeinander, die jeweils ihre eigene Geschichte haben und dadurch erklärbar werden. Aber auch hier verharrt der Autor im Wolkig-ungefähren der "Mentalität". China hatte gegenüber dem spätantiken, erst recht feudalen Europa lange Zeit einen beträchtlichen Vorsprung besessen. Doch zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatte sich das Verhältnis umgekehrt, denn in Europa hatte sich zuerst das Handels-, dann das Städtebürgertum in jahrhundertelangen Kämpfen einen immer größeren Anteil am gesellschaftlichen Mehrprodukt angeeignet, während in China eine allgegenwärtige, zentral geleitete Bürokratie dieses Mehrprodukt verschlang. Die chinesischen Kaiser setzten nach außen hin auf Abschottung, nach innen hin auf konsequente Unterbindung persönlichen Reichtums ("Akkumulation"), um, wie sie sagten, "Unruhen" zu verhindern. Fernhandel zur See war den mingzeitlichen Chinesen bei Todesstrafe untersagt, und so wagten sich nur die Mutigsten an solche Expeditionen. Es ist ganz erstaunlich, welche Kühnheit und Militanz gegen die "eigene Zentralregierung" diese Händler entwickelten, ganz wie die hochmittelalterlichen Fernkaufleute in Europa, aber im Unterschied zu diesen gelang es ihnen nicht, sich dauerhaft einen Anteil am Mehrprodukt, damit ökonomische und schließlich politische Selbständigkeit zu sichern. Die Bürokratie erwürgte mit den ihr zur Verfügung stehenden Gewaltmitteln, Militär und Justiz, jede Initiative, und das Resultat waren Stagnation, Lethargie und Lähmung. Durch Fleiß und Unternehmungsgeist angehäufter Reichtum hätte nur als Magnet für staatliche Sanktionen und Raubaktionen gewirkt und unterblieb daher. China geriet ins Hintertreffen und in den Opiumkriegen schließlich unter die Räder des Imperialismus. Eine Station, ein Indiz, ein Symptom dieses Abstiegs war das Desinteresse chinesischer Gelehrter an europäischen Kartenwerken, auch sie Ergebnisse eines erfolgreich gegen die Feudalität geführten bürgerlichen Klassenkampfes, der in China im Keim erstickt wurde. Diese wie zahlreiche andere Einsichten verdanke ich übrigens dem exzellenten Buch von Fritz Erik Hoevels über Marx und die von diesem entwickelte Wissenschaft ("Ökoanalyse"), das ich zur Vertiefung und Erweiterung der hier angeschnittenen Fragen nur empfehlen kann. *)
Mit Erstaunen liest man in Brooks Buch, daß die spanischen Kolonial-Desperados an der Wende zum 17. Jahrhundert erwogen, China zuerst mit 80 (!), dann mit mehreren hundert, schließlich mit einigen tausend Soldaten zu überfallen und zu besetzen, bevor sie Mitte des Jahrhunderts von diesem Vorhaben absahen. Aber warum? Das lag nicht nur an ihrer Niederlage im niederländischen Freiheitskrieg gegen die spanischen Besatzer - die holländischen Handwerker bauten einfach die besseren Feuerwaffen und hatten allen Grund dazu -, sondern an einer weiteren spanischen Schlappe in einem ganz anderen Winkel der Welt, die zu erwähnen einem Buch mit "globalem" Anspruch gut zu Gesicht gestanden hätte. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts erzwangen die Araukaner (im heutigen Chile) als einziger Indianerstamm Gesamtamerikas einen Friedensvertrag mit Madrid nach 150 Jahren verlustreicher Kämpfe, die einem Drittel der Araukaner das Leben kosteten. Was aber versetzte sie in die Lage, dem dreisten kolonialen Distelfink so kräftig eine zu langen, daß man sich schließlich auf "unentschieden" einigte? Absprache, Disziplin und organisierte Gegenwehr, mithin also ganz (zunft)bürgerliche Tugenden. Araukaner beiderlei Geschlechts hatten sich im Umgang mit Waffen und im Reiten zu üben. Wer von Frieden sprach, war vogelfrei, desgleichen, wer sich taufen ließ. Gefangene Spanier waren an Kinder auszuhändigen, damit diese sich im Foltern üben konnten (Inquisition bzw. Guantánamo einmal andersherum). Diese Form des - wie man heute sagen würde - "Terrorismus" sprach sich herum, bis nach Madrid, und kühlte das Kolonialmütchen merklich ab, bis hin zum Interventionsverzicht in China. Da haben wir ihn wieder, den ach so häßlichen Befreiungskampf, den ach so garstigen Klassenkampf.
Aber so klug darf ein Professor nicht sein - die Leser könnten ja auf die berühmten "dummen Gedanken" kommen, könnten die Anfänge der kapitalistischen Weltbeherrschung mit ihrem jetzigen würgenden monopolistischen Ende unter US-Diktat vergleichen, könnten Ausschau halten nach Beispielen und Modellen erfolgreicher Gegenwehr. Nein - so klug darf kein Professor sein ...
Daß Brook bei allem kulturellen Naschwerk, das er bietet - und das z. T. vorzüglich -, affirmativ und apologetisch bis ans Akademikerherz hinan ist, wurde hinlänglich aufgezeigt, tritt aber bei seiner Paradedisziplin, der lebendig geschriebenen Geschichte des Tabakkonsums, besonders erschreckend zutage. Gegen Ende seiner instruktiven Übersicht zitiert er einen gewissen Berthold Laufer, angeblich ein Universalgelehrter, der im Jahre 1924 ein hymnisches Lob auf das Rauchen anstimmte. Es klingt wie eine schöne Melodie aus längst versunkener besserer Zeit und soll dem Leser dieser Zeitschrift nicht vorenthalten werden:
"Von allen Gaben der Natur hat sich Tabak als der mächtigste soziale Faktor erwiesen, der fähigste Friedensstifter und größte Wohltäter der Menschheit. Er hat die Menschen auf der ganzen Welt verwandt gemacht und in einem gemeinsamen Bund vereinigt. Von allen Luxusgütern ist Tabak das demokratischste und universellste; er hat viel dazu beigetragen, die Welt zu demokratisieren."
Natürlich ließe sich an dieser Eloge einiges aussetzen - die Jahre 1789 und 1917 waren an dieser Demokratisierung nicht ganz unbeteiligt, möchte man einwenden -, aber was sagt unser Verfasser?
"Und nun scheint auch das lange Zeitalter des globalen Tabakkonsums ruckartig seinem Ende entgegenzugehen. (...) Auch wenn es weltweit immer noch Hunderte Millionen von Rauchern gibt, würde diese Ansicht heute wohl niemand mehr vertreten. Genuß und Gesundheit gehen inzwischen in verschiedene Richtungen." (S. 163)
Unsäglicher ideologischer Bockmist, übles und dabei hochnäsiges Propaganda-Neusprech - von wegen "Gesundheit" ... Eine mit allen technischen Mitteln ausgestattete, die ganze Welt in Krallen haltende US-Monopolherrschaft, die gerade ihre letzten Gegner liquidiert, rund um den Globus einheitlich ihre Unisono-Propaganda hämmern läßt, auch das letzte Bankkonto ausspäht und plündert, die großen Städte der Welt mit ihren Kameras erfaßt und überwacht - dieses bürokratische Monstrum, diese Krake mit ihren unzähligen Würgearmen geht nun dazu über, gängelnd, bevormundend und strafend in den persönlichsten Lebensbereich einzugreifen. Tabakkonsum in Gaststätten und auf öffentlichen Plätzen ist ein Vehikel der Kommunikation, und diese gilt es zu ersticken, auf daß ein jeder vor der Glotze in hirntötender Isolation und Beschallung sich für den "Arbeitsmarkt" bereithalte, den es ohnehin nicht mehr gibt. Ideologischer Nebel statt Tabakqualm, sozusagen ...
Aber nein: So klug darf ein Professor nicht sein. Er soll Histörchen erzählen, sie mit Anekdötchen würzen und das Wesentliche umgehen oder zerquasseln oder madig machen. In seiner Danksagung schreibt der Verfasser: "Teilweise wurde dieses Vorhaben von dem Project on Globalisation and Autonomy (...) an der McMaster Universität (Ontario) finanziert. (...) Ich hatte auch das Glück, über viele Jahre vom Social Sciences and Human Research Council of Canada Unterstützung zu bekommen. Ein Forschungsstipendium von der John Simon Guggenheim Memorial Foundation erleichterte es mir, das Manuskript abzuschließen."
Ach ja: der Tui und der Brotkorb (für Brecht-Kenner). Wäre er so klug, wie er sein müßte, um sein Honigthema ohne ideologische Teerschlacken darzubieten, dann hätte die Stipendienherrlichkeit jedenfalls ein jähes Ende.
Ketzerbriefe



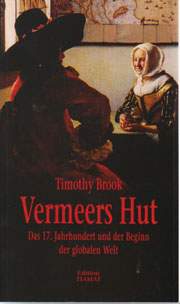 Es verhält sich nicht so, daß dem intelligenten Verfasser Marxens Analysen unbekannt geblieben wären; so prägt er beispielsweise bei der Besprechung von Vermeers Bild "Frau mit einer Waage" - es zeigt eine schwangere Frau beim Wägen von Silbermünzen - den bedenkenswerten wie bedenklichen Ausdruck von der "Ethik der Akkumulation" (S. 168). Was will er damit besagen? Wo das Wort "Ethik" fällt, ist die Theologie nicht weit. Dieser Ausdruck bezieht sich, und insoweit ist er korrekt, auf das Selbstverständnis der protestantischen Handels-und Manufakturbourgeoisie, daß das Anhäufen von Reichtum keine Todsünde - wie die kath. Kirche als Suggestionsapparat und hauptsächlicher Nutznießer der feudalen Ausbeutung wetterte -, sondern gottgewollt sei, oder in den Worten von Brook: "Gelderwerb ist eine Tugend, solange er auf ehrliche Weise geschieht." Aber was, bitteschön, soll denn hier "ehrlich" bedeuten? Man merkt dem Verfasser an, daß er, so viele "Türen" in die Vergangenheit er auch aufstößt, den eng begrenzten Horizont des behaglichen bürgerlichen Interieurs nicht zu überschreiten vermag. Marx bezeichnet als Wesensmerkmal der "ursprünglichen Akkumulation" das massenhafte Entstehen "freier" Produzenten, "frei" im Doppelsinne von persönlich-juristischer Freiheit (von den Fesseln der Leibeigenschaft nämlich) und "frei" - d. h. beraubt, enteignet - von Produktionsmitteln, und fügt die scharfsinnige Beobachtung hinzu, daß die bürgerliche Geschichtsschreibung nur den ersten, personenrechtlichen Aspekt dieser Freiheit in höchsten Tönen preist, während sie den zweiten Aspekt, die mittels brutaler Gewalt, Brandeisen und Galgen durchgeführte Enteignung der Kleinproduzenten, um sie zur Lohnarbeit erpreßbar zu machen, mit noblem Schweigen übergeht. Nichts Neues also unter der Sonne: "Ehrlicher Gelderwerb" - die Illusion der Bourgeoisie über sich selbst, die der Verfasser so gerne teilt - bedeutet während des 17. Jahrhunderts im Weltmaßstab Eroberung, Plünderung und Mord, aber in Holland selbst, als der "kapitalistischen Musternation des 17. Jahrhunderts", wie Marx sie bezeichnete? Darüber erfährt man bei Brook mit seiner heimeligen Wohnzimmerperspektive nichts, und so müssen wir uns abermals an Marx halten: "Hollands Volksmasse war schon 1648 mehr überarbeitet, verarmter und brutaler unterdrückt als die des übrigen Europas insgesamt" (ebd. 782). "Ehrlicher Gelderwerb"! "Ethik der Akkumulation"! Erst vor dem Hintergrund von Marxens Analyse wird verständlich, warum sich Zigtausende von Holländern für diese "Handelsfahrten" anheuern ließen, die einen ungeheuren Tribut an Menschenleben - zwischen einem Drittel und der Hälfte der Mannschaften - forderten: Das Elend der kapitalistischen Ausbeutung trieb die besitzlosen Holländer (später Engländer) auf die Schiffe und in die Welt. Wenn sie Glück hatten, konnten sie ihr Dasein auf Kosten der Rot-, Gelb-und Schwarzhäute fristen. Aber diese Dynamik bleibt dem Leser des Buches verborgen, vorsätzlich verborgen.
Es verhält sich nicht so, daß dem intelligenten Verfasser Marxens Analysen unbekannt geblieben wären; so prägt er beispielsweise bei der Besprechung von Vermeers Bild "Frau mit einer Waage" - es zeigt eine schwangere Frau beim Wägen von Silbermünzen - den bedenkenswerten wie bedenklichen Ausdruck von der "Ethik der Akkumulation" (S. 168). Was will er damit besagen? Wo das Wort "Ethik" fällt, ist die Theologie nicht weit. Dieser Ausdruck bezieht sich, und insoweit ist er korrekt, auf das Selbstverständnis der protestantischen Handels-und Manufakturbourgeoisie, daß das Anhäufen von Reichtum keine Todsünde - wie die kath. Kirche als Suggestionsapparat und hauptsächlicher Nutznießer der feudalen Ausbeutung wetterte -, sondern gottgewollt sei, oder in den Worten von Brook: "Gelderwerb ist eine Tugend, solange er auf ehrliche Weise geschieht." Aber was, bitteschön, soll denn hier "ehrlich" bedeuten? Man merkt dem Verfasser an, daß er, so viele "Türen" in die Vergangenheit er auch aufstößt, den eng begrenzten Horizont des behaglichen bürgerlichen Interieurs nicht zu überschreiten vermag. Marx bezeichnet als Wesensmerkmal der "ursprünglichen Akkumulation" das massenhafte Entstehen "freier" Produzenten, "frei" im Doppelsinne von persönlich-juristischer Freiheit (von den Fesseln der Leibeigenschaft nämlich) und "frei" - d. h. beraubt, enteignet - von Produktionsmitteln, und fügt die scharfsinnige Beobachtung hinzu, daß die bürgerliche Geschichtsschreibung nur den ersten, personenrechtlichen Aspekt dieser Freiheit in höchsten Tönen preist, während sie den zweiten Aspekt, die mittels brutaler Gewalt, Brandeisen und Galgen durchgeführte Enteignung der Kleinproduzenten, um sie zur Lohnarbeit erpreßbar zu machen, mit noblem Schweigen übergeht. Nichts Neues also unter der Sonne: "Ehrlicher Gelderwerb" - die Illusion der Bourgeoisie über sich selbst, die der Verfasser so gerne teilt - bedeutet während des 17. Jahrhunderts im Weltmaßstab Eroberung, Plünderung und Mord, aber in Holland selbst, als der "kapitalistischen Musternation des 17. Jahrhunderts", wie Marx sie bezeichnete? Darüber erfährt man bei Brook mit seiner heimeligen Wohnzimmerperspektive nichts, und so müssen wir uns abermals an Marx halten: "Hollands Volksmasse war schon 1648 mehr überarbeitet, verarmter und brutaler unterdrückt als die des übrigen Europas insgesamt" (ebd. 782). "Ehrlicher Gelderwerb"! "Ethik der Akkumulation"! Erst vor dem Hintergrund von Marxens Analyse wird verständlich, warum sich Zigtausende von Holländern für diese "Handelsfahrten" anheuern ließen, die einen ungeheuren Tribut an Menschenleben - zwischen einem Drittel und der Hälfte der Mannschaften - forderten: Das Elend der kapitalistischen Ausbeutung trieb die besitzlosen Holländer (später Engländer) auf die Schiffe und in die Welt. Wenn sie Glück hatten, konnten sie ihr Dasein auf Kosten der Rot-, Gelb-und Schwarzhäute fristen. Aber diese Dynamik bleibt dem Leser des Buches verborgen, vorsätzlich verborgen. 

Kommentare_